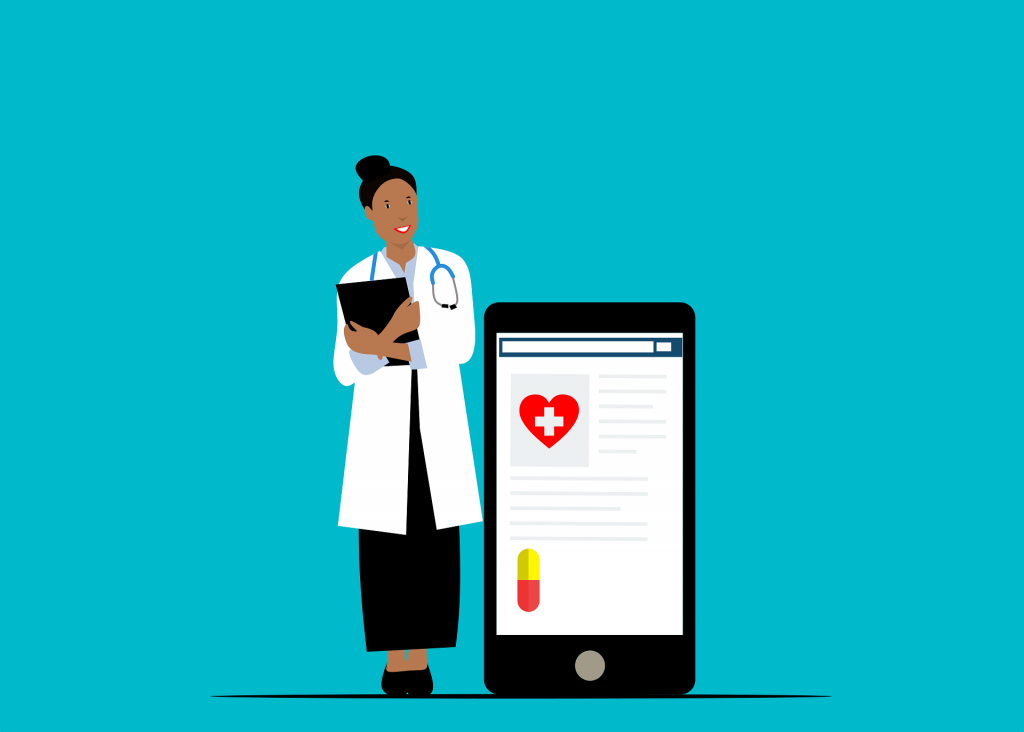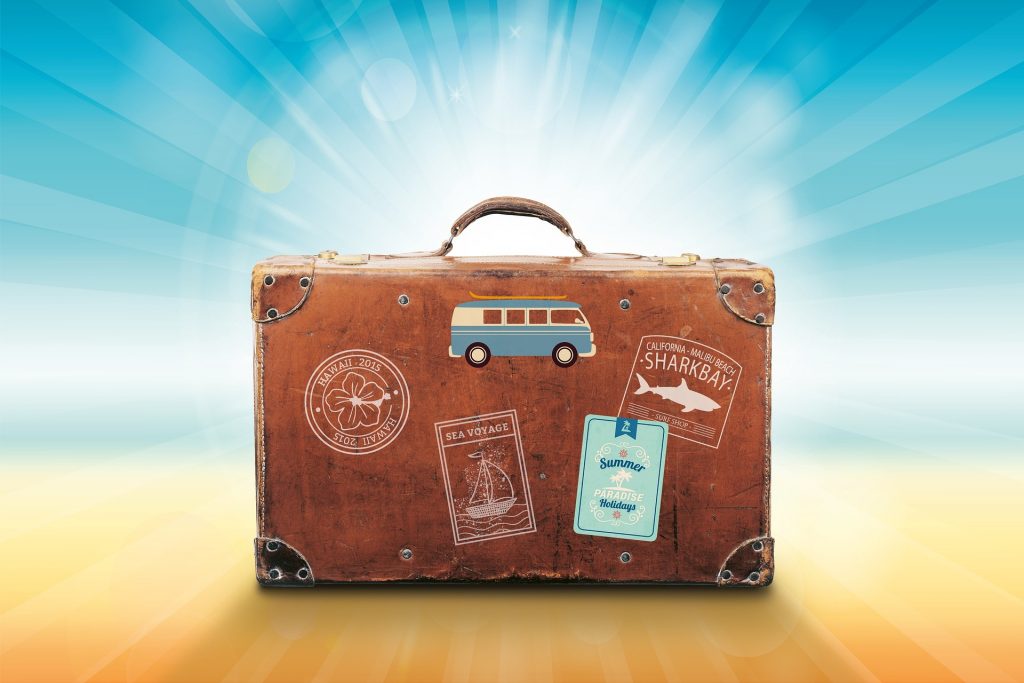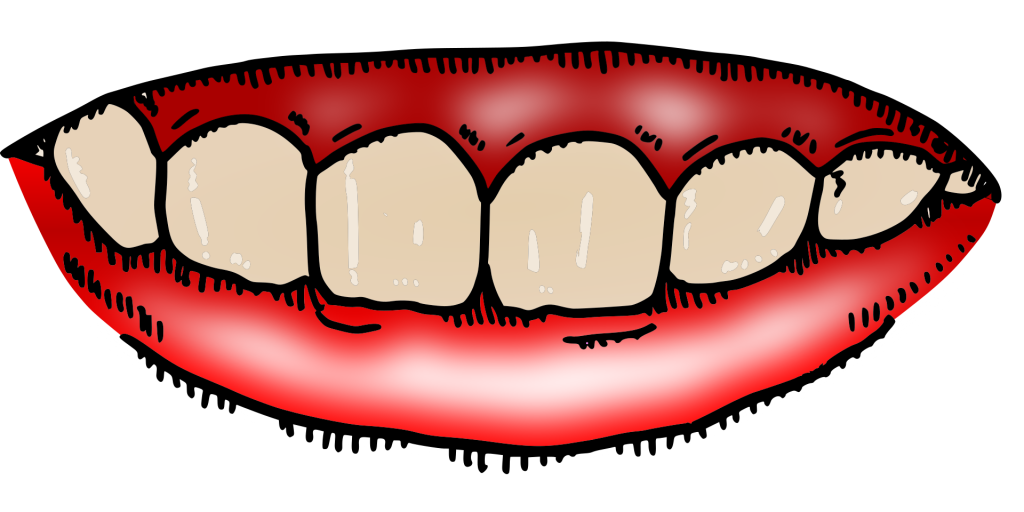Über einen historischen Sonntagvormittag im Büro, über einen Berufsweg, der die Zeitenwende in der Dentaltechnik geradezu exemplarisch markiert, über mitdenkende Mitarbeiter, die DNA eines Unternehmens, über Erkenntnisgewinne aus der Pandemie, über Analogie im Digitalzeitalter, den unumkehrbaren Wandel in der Beziehung zwischen Zahnmedizin und Zahntechnik, über ein bisschen Freizeit, einen jüngsten Sohn, der beim FC Barcelona studiert, und die Liebe der Familie zu einem Adler sprach Journalist Bernd Overwien für DENTAGEN INFO mit Michael Göllnitz (55), Geschäftsführer der Amann Girrbach GmbH am deutschen Standort in Pforzheim.
Mögen Sie Überraschungen?
Nun ja, wenn am Ende ein positives Ergebnis steht, gern.
Wie groß war die Überraschung, als Jutta Girrbach nach 25 Jahren im Unternehmen vor inzwischen gut zwei Jahren ihr Ausscheiden aus der Geschäftsführung bekannt gab?
Ja, das kam wirklich unerwartet. Ich stand auf dem Tennisplatz, als sie vorschlug, sich am Sonntagvormittag im Büro zu treffen.
Sie waren da schon ihr langjähriger Vertriebsleiter. Ist Ihnen da der Gedanke gekommen, da muss etwas Außergewöhnliches anstehen?
Schon. Aber Jutta Girrbach hat in dritter Generation die Entwicklung des Unternehmens deutlich vorangetrieben. Die Fusion mit der österreichischen Amann Dental hat sie maßgeblich mitgestaltet. Das war die entscheidende Weichenstellung, um zu einem führenden Anbieter in der digitalen Dentaltechnik zu werden. Als Sie mir anbot, die freiwerdende Position eines Geschäftsführers zu übernehmen, bin ich in diesem Moment fest davon ausgegangen, wir machen das jetzt gemeinsam.
Wie perplex waren Sie, als die Enkelin des Firmengründers das mit ihrer ganz persönlichen Zeitenwende verband?
Ziemlich perplex. Aber sich in der Mitte eines erfolgreichen Berufslebens zu entscheiden, jetzt die Dinge zu tun, die in einem 9-to-7-Job nicht möglich sind, verdient größten Respekt. Gemeinsam mit ihrem Mann engagiert sie sich heute in sozialen Projekten, ist in der Notfallseelsorge mit großer Empathie unterwegs.
Schaut sie noch mal ab und zu im Unternehmen vorbei?
Ja, natürlich. Wir tauschen uns regelmäßig aus. Ich habe ja quasi die Ertüchtigung des Standortes Pforzheim geerbt. Handwerker, so weit dass Auge reichte. Da gab es viel Gesprächsbedarf. So gesehen, ist die Familie ja noch dabei. Jutta Girrbach ist ja nicht gegangen, weil sie keine Lust mehr hatte, Unternehmerin zu sein. Das war eine bewusste Entscheidung für einen zweiten Lebensentwurf.
„Ich habe mich gefühlt wie der Prinz von Pakistan“
Mit Wolfgang Reim, CEO der Amann Girrbach AG im österreichischen Koblach, führen Sie ein erfolgreiches Unternehmen mit 160 professionellen Mitarbeitern weiter in die digitale Dentalwelt. Sie kommen ja ursprünglich aus der Edelmetallbranche, da trug man einst die Nase ja ziemlich hoch. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund Ihren heutigen Führungsstil charakterisieren?
Das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber in der Tat gab es Zeiten, da wurden Entwicklungen wie bei Girrbach eher gönnerhaft belächelt. Ich habe mal gesagt, mich als totaler Edelmetaller wie der „Prinz von Pakistan“ gefühlt zu haben. Aber das war vor mehr als 20 Jahren. Und in diesen zwei Jahrzehnten hat sich der ganze Markt total gedreht. Plötzlich war ein Angebot von Girrbach so, als ob man Trainer von Borussia Dortmund werden soll.
…dürfen wir da noch später drauf kommen…?
…ja, habe schon gehört, am Ende kommt immer die Fußballfrage…
Nein, was die Frage nach dem Führungsstil anbetrifft, denke ich, im Laufe der Jahre eine eigene Art der Führung entwickelt zu haben. Der ist grundsätzlich kooperativ und fördernd. Bei uns fliegen keine Türen, wiewohl stellt sich da manchmal eine gewisse Grantigkeit ein, wenn wichtige Sachen einfach nicht funktionieren. Deshalb schätze ich es sehr, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ein Problem auch einen Lösungsansatz haben. Wenn sie sich Gedanken machen.
Corona hat das Management eines jeden Unternehmens herausgefordert. Wie haben Sie agiert?
Praktisch. Wir haben angefangen zu testen, da hatte das kaum jemand auf dem Schirm. Wir haben Schulungen beim DRK angeboten, um Selbsttests richtig durchführen zu können. Natürlich haben wir ab der zweiten Woche der Pandemie unsere Außendienstler nach Hause geschickt. Wir haben sogar ein Reiseverbot erteilt. Homeoffice so weit wie möglich. Das versteht sich von selbst.
War die Pandemie-Phase für viele Manager auch ein Erkenntnisgewinn?

Ja, sicher. Besprechungen mit Mitarbeitern per Video, ohne viel Papier, direkte Kommunikation. In vielen Unternehmen wurde deutlich, dass nicht die physische Präsenz im Büro zählt, sondern das Erreichen vereinbarter Zahlen und Ziele. Chefs können ja während einer Pandemie nicht mehr so einfach durch die Firma gehen und prüfen, ob alles gut läuft. Kennzahlen und Reports bekommen dadurch eine größere Bedeutung. Selbst unsere vielen Außendienstler, die längst Gebietsmanager mit vielfältigen Aufgaben sind, haben verinnerlicht, dass direkte Kundengespräche im Netz sehr wohl eine erfolgreiche Form der Kommunikation sein können. Aber auch da gilt der Grundsatz, die Philosophie des Unternehmens mit Überzeugung und Leidenschaft, mit ehrlicher Emotion rüberzubringen.
…und man muss die richtigen Fragen stellen können.
Richtig. So beim Tässchen Kaffee zu fragen, wo drückt der Schuh, reicht heute nicht mehr. Ich muss zuhören können, ja, aber ich muss dem Kunden heute gerade in der digitalen Kommunikation unmittelbar einen Nutzwert anbieten können.
Als Vertriebler mit Leib und Seele, der so aus Ihnen spricht: haben Sie selbst noch persönlichen Kundenkontakt?
Zu wenig. Ich habe mir für 2023 fest vorgenommen, wieder viel mehr draußen zu sein. Aber die neue Zeit bietet halt neue Möglichkeiten. Wir sprechen ja jetzt hier auch über TeamViewer.
„Keine Marketingfloskel – das ist unsere DNA!“
Wir sind Amann Girrbach. Wir setzen Maßstäbe. Ist das „mir san mir“?
Wir alle in der Unternehmensgruppe setzen neue Maßstäbe in der digitalen Zahntechnik. Als Pionier in der Dentalen CAD- und CAM-Technologie sind wir einer der führenden Innovatoren und bevorzugten Full-Service-Anbieter in der digitalen Zahnprothetik. Wir sind selbstbewusst genug, zu sagen: mit unserem hohen Maß an Entwicklungskompetenz und Engagement für die Kundenorientierung schaffen und verbreiten wir anspruchsvolle Systemlösungen für die zukünftige Praxis von Vorarlberg und Pforzheim in die Welt. Möglich ist das durch die Innovationen und exzellenten Produkte, die im Headquarter in Österreich entwickelt und produziert werden. Der Standort in Pforzheim steht für effizienten Direktvertrieb, für Support- und Trainingsfunktionen sowie Logistik und Verwaltung. Das mag sich anhören wie eine wohlfeil formulierte Marketingfloskel, aber das ist unsere DNA.
Journalisten haben bekanntlich zwei linke Hände. Mir ist es jüngst nur mit Hilfe eines Youtube-Filmchens gelungen, den neuen Staubsauger in Funktion zu bringen. Zeigen Sie Ihren Kunden auch im Internet, wie es geht?
Shorts wie bei Youtube, also kurze Infovideos, spielen bei uns eine große Rolle. Sei es zu technischen Fragen, zur Bedienung von Produkten und vielem mehr. Das betreiben wir fast schon exzessiv. Quasi im Umkehrschluss haben wir auch unser Kurszentrum in Pforzheim komplett renoviert, unser Trainerteam kundenorientiert qualifiziert.
Analogie im Digitalzeitalter?
Wer bei uns neu einsteigt und beispielsweise ein Ceramill CAD/ CAM-System erwirbt, für den ist ein Basic-Training von drei Tagen hier vor Ort obligat. Wir würden niemanden sagen, „Plug and Play“ es wird schon klappen. Nein, das geht schief. Siehe Staubsauger!
Mit welchem Konzept ist die Amann Girrbach Akademie unterwegs?
Es geht heute nicht mehr als E-Learning „ja oder nein“, sondern ob man es sich leisten kann, diesem Trend nicht zu folgen. Die Akademie hat eine komplett digitale Lösung des Know-how-Transfers entwickelt. Digitale Herstellung von Zahnersatz auch digital vermitteln – eine Anforderung, der wir im internationalen Markt gerecht geworden sind. Sie können sich quasi alles herunterladen, wie man so schön sagt.
Rückt die Feminisierung der Medizin, insbesondere der Zahnmedizin, den Aspekt der „Work-Life-Balance“ wirklich so dominierend in den Vordergrund?
Wir alle wissen ja: viele zukünftige Zahnärztinnen planen keine klassische Einzelpraxis zu haben. Da das Thema Prothetik im zahnmedizinischen Studium ja nicht mehr diese Rolle spielt, wird allerspätestens die nächste Generation Zahnärztinnen und Zahnärzte verstärkten zahntechnischen Support benötigen und aktiv einfordern. Das ist doch die Perspektive für die Zahntechnik in Deutschland.
Fräszentrum in Shanghai kann nicht vor Ort sein
Hat die Zukunft schon begonnen?
Ja, für Labore mit kompetentem Außendienst, mit Mitarbeitern, die auch am Stuhl stehen können. Das muss in Zukunft möglich sein, wenn es beispielsweise darum geht, eine komplexe Implantat-Konstruktion zu verschrauben. Das muss die Zahntechnik dürfen können. Beide Spezialisten zum Wohle des Patienten im miteinander!
Aber das wird einigen Zahnärzten nicht unbedingt gefallen?
Mag sein. Die Zeit, „Ich bin der Doktor, ich weiß das besser“ ist eigentlich schon vorbei. Am Ende des Tages wird es so sein, dass Zahnmedizin und Zahntechnik gerade auf digitaler Ebene auf Augenhöhe agieren werden müssen. Da sind wir uns sicher.
Was macht Sie so sicher?
Wenn die Praxis um die Ecke einen Intraoralscanner einsetzt, werden die Patienten ihrem Zahnarzt Fragen stellen. Die Praxis kommt am Thema Digitalisierung nicht mehr vorbei. Die Zahntechnik ist digital gut aufgestellt. Wir sagen unseren Kursteilnehmern im Rahmen dieser Thematik, zeigt euren Zahnärztinnen und Zahnärzten, wie der Workflow zwischen Praxis und Labor funktioniert oder funktionieren kann. Die Sorge war ja, der Scanner könnte die Zahntechnik aus der Wertschöpfungskette nehmen. Aber ein Fräszentrum in Shanghai oder München kann dem Zahnmediziner vor Ort keine Unterstützung anbieten.
Sie persönlich, wozu nehmen Sie sich Zeit?
Ich entspanne am besten beim Kochen. Ich gehe mit meiner Partnerin gern wandern. Was ich wieder lernen musste, weil ich es lange nicht gemacht habe, ist Urlaub. Keine Selbstironie. Und ich versuche im nächsten Sommer viel Tennis zu spielen. E-Bike macht im Taunus ja auch Sinn. Fußball ist am Rande auch noch ein Thema.
Haben Sie aktiv gekickt?
Ja, 40 Jahre lang. War ein brauchbarer Torwart bis in die Landesliga. Das letzte Spiel habe ich mit 51 Jahren in der B-Klasse gemacht.
Sie haben eine Tochter und drei Söhne. Kicken die auch?
Ja, Fußball ist das Ding in der ganzen Familie. Der jüngste Sohn studiert in Barcelona Sportwissenschaften in Verbindung mit dem FC Barcelona. Mit 21 Jahren ist er aber schon über das Alter hinaus, als Fußballer entdeckt zu werden.
Interessant. Wie muss man sich ein Studium bei Barca vorstellen?
Da geht es um Sportmanagement. Da werden Manager und Spielerberater quasi herangezogen.
Und welcher Klub treibt bei Ihnen zuweilen den Blutdruck hoch?
Die Wahrheit gebietet es: als gebürtiger Münchener war ich ein junger Bayern-Fan. Meine Eltern waren das auch. Meine Mutter hat mich im roten Trainingsanzug mit drei weißen Streifen in die Schule geschickt. Selbst nach dem Umzug in den Taunus. Da gab es natürlich jede Menge „Holz“. So mit 30 Jahren bin ich dann „übergelaufen“ und letztlich auch meinen Kindern zu Liebe ein Fan von Eintracht Frankfurt geworden. Die ganze Familie liebt den Adler.
Gehen Sie ins Stadion?
Ja, immer wenn wir Karten bekommen – was ja heute in Frankfurt nicht mehr so einfach ist. Wenn es geht, sind wir da. Na klar!
Herr Göllnitz, herzlichen Dank für das Gespräch.