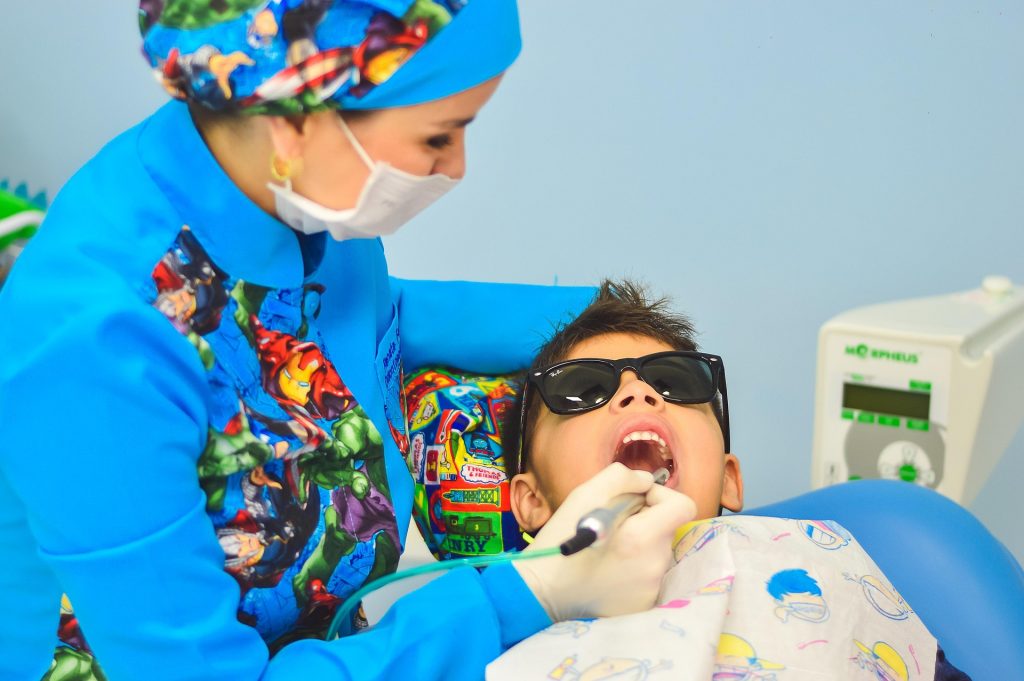Im kommenden Jahr steigt der Mindestlohn, das Deutschlandticket wird teurer und für Rentnerinnen und Rentner könnte es mehr Geld geben. Auch steuerliche Entlastungen treten in Kraft. Ein Überblick, was auf Bürgerinnen und Bürger im neuen Jahr zukommt, zeigt dieser Artikel.
Mindestlohnerhöhung / Höhere Minijob-Grenze
Der Mindestlohn steigt zum 1. Januar auf 13,90 Euro pro Stunde. Auch für Auszubildende ist etwas mehr Geld drin. Die Mindestvergütung im ersten Lehrjahr steigt auf 724 Euro. Auch in den weiteren Ausbildungsjahren gibt es höhere Mindestsätze: im zweiten Jahr 854 Euro, im dritten 977 und in einem vierten Ausbildungsjahr 1.014 Euro monatlich. Parallel zur Mindestlohnerhöhung steigt auch die Obergrenze für sogenannte Minijobs. Diese erhöht sich ab Januar von 556 auf 603 Euro im Monat.
Deutschlandticket wird teurer
Ab Januar steigt der Preis für ein Deutschlandticket von 58 auf 63 Euro pro Monat. Rund 14 Millionen Menschen nutzen nach Branchenangaben das Abo, das bundesweit Fahrten im Regional- und Nahverkehr ermöglicht.
Steuerfreibetrag steigt
Der steuerliche Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuer gezahlt werden muss, steigt 2026 auf 12.348 Euro. Der Kinderfreibetrag wird auf 9.756 Euro angehoben.
Rentenerhöhung
Rentnerinnen und Rentner können sich auf etwas mehr Geld auf dem Konto freuen: Ihre Renten sollen zum 1. Juli angehoben werden. Die Erhöhung könnte sich um die 3,7 Prozent bewegen, wie aus einem Entwurf für den jährlichen Rentenversicherungsbericht hervorgeht. Der Wert ist aber nur eine Schätzung. Wie stark die Rente steigt, legt das Bundeskabinett immer erst im Frühjahr je nach aktueller Konjunkturlage und Lohnentwicklung fest.
Mehr Geld für Kinder
Das Kindergeld wird zum 1. Januar um vier Euro auf 259 Euro pro Monat erhöht.
Pendlerpauschale
Die Pendlerpauschale soll nach den Plänen der schwarz-roten Bundesregierung dauerhaft auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer erhöht werden. Aktuell liegt sie für die ersten 20 Kilometer Wegstrecke bei 30 Cent pro Kilometer. Ab dem 21. Kilometer kann man 38 Cent ansetzen. Das Bundeskabinett hat die Entlastung bereits beschlossen, jedoch müssen Bundestag und Bundesrat dem noch zustimmen.
Post von der Bundeswehr
Im Zuge des neuen Wehrdienstgesetzes wird eine Wehrerfassung wieder eingeführt. Das bedeutet für alle 18-jährigen Männer und Frauen, dass sie ab Anfang 2026 einen Fragebogen erhalten sollen, mit dem ihre Eignung und ihre Motivation für die Bundeswehr erhoben wird. Männer müssen diesen dann verpflichtend ausfüllen, Frauen können ihn freiwillig abgeben. Bundesrat und Bundestag haben den Plänen noch nicht zugestimmt.
Recht auf Ganztagsbetreuung in Grundschulen
Wenn Kinder vom Kindergarten in die Grundschule kommen, kann das für Eltern zu Engpässen in der Kinderbetreuung führen. Ab dem Schuljahr 2026/2027 sollen zunächst alle Erstklässlerinnen und Erstklässler einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in den Schulen haben. Dieser Anspruch wird in den kommenden Jahren um je eine Klassenstufe pro Jahr ausgeweitet.
Aus Bürgergeld wird Grundsicherung – strengere Sanktionen
Das Bürgergeld soll künftig Grundsicherung heißen und wer Termine im Jobcenter ohne zwingenden Grund versäumt oder eine Arbeitsaufnahme verweigert, soll dies härter zu spüren bekommen. Bislang wurde aus einem Gesetzentwurf bekannt, dass künftig direkt mit einer 30-prozentigen Kürzung bestraft werden kann, falls jemand zum Beispiel eine Weiterbildung abbricht oder Bewerbungen nicht abschickt.
Wer Termine im Jobcenter ohne wichtigen Grund nicht wahrnimmt, dem droht ab dem zweiten verpassten Termin ebenfalls eine Kürzung um 30 Prozent, ab dem dritten nicht wahrgenommenen Termin eine komplette Streichung der Zahlung. Das hat das Kabinett aber noch nicht beschlossen und auch im parlamentarischen Verfahren sind Änderungen der Pläne möglich.
Mehrwertsteuer für die Gastronomie
Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie soll dauerhaft von 19 auf 7 Prozent reduziert werden. Das galt auch schon während der Corona-Pandemie. Auch diese Entlastung ist noch nicht endgültig beschlossen. Wegen der dadurch befürchteten Milliardeneinbußen kam von den Ländern teils deutliche Kritik.
Aktivrente
Wer sich in der Rente noch etwas dazuverdienen möchte, soll steuerliche Vorteile bekommen. Beschäftigte im Rentenalter sollen mit der sogenannten Aktivrente bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei dazuverdienen dürfen. Das Gesetz dafür muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Die Vorteile gelten nicht für Selbstständige, Freiberufler, Land- und Forstwirte, Minijobs und Beamte.
Höhere Sozialabgaben für Gutverdiener
Gutverdiener sollen turnusmäßig höhere Sozialabgaben zahlen. In der gesetzlichen Rentenversicherung werden künftig voraussichtlich bis zu einem Monatseinkommen von 8.450 Euro Beiträge fällig. Wer mehr verdient, zahlt nur bis zu dieser Grenze Rentenbeiträge. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung soll auf 5.812,50 Euro pro Monat steigen.
Steuerliche Entlastungen für Ehrenamtler
Die Steuerpauschale für Übungsleiter soll von 3.000 auf 3.300 Euro angehoben werden. Die Ehrenamtspauschale soll von 840 auf 960 Euro steigen. Das betrifft etwa Trainer im Sportverein oder auch ehrenamtliche Chorleiter. Bundestag und Bundesrat müssen dem noch zustimmen.
Außerdem sollen Haftungsrisiken für Ehrenamtler verringert werden. Von ihnen verursachte Schäden müssen sie künftig nur dann ersetzen, wenn diese vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bislang galt das nur bei einer Vergütung von 840 Euro, künftig soll diese Grenze bei 3.300 Euro liegen.
Lachgas-Verbot für Minderjährige
Das als Partydroge populäre Lachgas soll für Kinder und Jugendliche künftig verboten werden. Das heißt, die Abgabe an Kinder ist nicht erlaubt, auch der Online-Handel und der Kauf an Selbstbedienungsautomaten soll untersagt werden. Der entsprechende Gesetzentwurf muss noch durch den Bundesrat.
Wahljahr
Fünf Bundesländer wählen absehbar neue Landesparlamente. Baden-Württemberg beginnt am 8. März, am 22. März wählen die Menschen in Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag, am 6. September ist dann Sachsen-Anhalt an der Reihe. Am 20. September gibt es Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.
Bulgarien bekommt den Euro
Ab dem 1. Januar ersetzt Bulgarien den Lew durch den Euro. Für Urlauber wird damit vieles einfacher: Geldwechsel und zusätzliche Gebühren entfallen, Preise lassen sich einfacher vergleichen und Kartenzahlungen werden unkomplizierter. Der feste Umrechnungskurs liegt bei 1,95583 Lew pro Euro – exakt derselbe, zu dem einst die D-Mark in den Euro überging. Allerdings rechnen Beobachter mit leicht steigenden Preisen in Hotels und Restaurants.
Fleischkennzeichnung: Staatliches Tierhaltungslogo
Eigentlich hätte das staatliche Tierhaltungslogo schon im August starten sollen, nun soll die Kennzeichnungspflicht am 1. März kommen – zunächst für Schweinefleisch im Supermarkt. Das Siegel soll beim Fleischkauf mehr Klarheit über die Bedingungen in den Ställen bringen. Fleischliebhaber erfahren so auf einen Blick, wie die Tiere gehalten wurden. Vorgesehen sind fünf Kategorien, von der Stufe «Stall» mit den gesetzlichen Mindestanforderungen bis hin zu «Bio». Seit 2019 gibt es bereits eine freiwillige Kennzeichnung für Schwein, Rind und Geflügel mit dem Aufdruck «Haltungsform».
Klarheit beim Honigkauf
Wer beim Frühstück gerne Honig aufs Brötchen streicht, kann bald genauer hinschauen: Ab dem 14. Juni müssen auf jedem Glas alle Ursprungsländer angegeben werden, wenn es mehrere sind – inklusive Prozentangabe nach Menge. Bisher reichte oft die pauschale Formulierung «Mischung aus EU- und Nicht-EU-Ländern». Gläser, die vor dem Stichtag nach den alten Regeln abgefüllt wurden, dürfen aber weiterhin verkauft werden.
Weniger Kosten für Gas?
Ab Januar fällt die Gasspeicherumlage für Gaskunden weg. Bislang kostete sie einen Vierpersonenhaushalt je nach Verbrauch rund 30 bis 60 Euro pro Jahr. Die Umlage diente dazu, die staatlich angeordnete Befüllung der Gasspeicher nach der Energiekrise 2022 zu finanzieren und machte bei Privatkunden rund 2,4 Prozent des Gaspreises aus. Die Kosten übernimmt nun einmalig der Bund. Da sich der Gaspreis aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, sinken die Endpreise nicht automatisch.
Schufa-Score wird transparenter
Wer einen Kredit braucht, kann ab dem ersten Quartal seinen Schufa-Score digital und kostenlos einsehen – entweder in der Schufa-App oder online. Bisher war oft unklar, wie die Bonität berechnet wird. Mit dem neuen, vereinfachten Score-Modell sollen auch Laien den Score ohne großen Aufwand nachrechnen können: Für zwölf Kriterien werden Punkte vergeben, die insgesamt von 100 bis 999 reichen. Je höher die Gesamtpunktzahl, desto besser gilt die Kreditwürdigkeit des Verbrauchers.
Mögliche Preisänderungen für Kfz-Policen
Zum 1. Januar 2026 ändert sich für rund jeden vierten Versicherten in der Kfz-Haftpflicht die Regionalklasse – und damit möglicherweise auch der zu zahlende Beitrag. Rund 5 Millionen Autofahrerinnen und Autofahrer rutschen in eine höhere Einstufung, für knapp 5,3 Millionen wird es günstiger. Für die Mehrheit ändert sich aber nichts. Entscheidend ist, wie oft und wie teuer Unfälle im eigenen Zulassungsbezirk waren: Regionen mit vielen Schäden landen in höheren Klassen, ruhige Bezirke werden belohnt.
Neuer Ehrentag
Am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, rückt das Ehrenamt in den Fokus. An dem Tag ist ein bundesweiter Mitmachtag geplant, der ehrenamtliches Engagement sichtbarer machen und in seiner Bedeutung für die Demokratie würdigen sollen. Initiator der bundesweiten Aktion ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Ende der Umtauschfrist für Führerscheine aus den Jahren 1999 bis 2001
Nach und nach müssen alle Führerscheine, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt worden sind, gegen den neuen EU-Führerschein umgetauscht werden. Bis zum 19. Januar sind Führerscheine mit Ausstellungsdatum zwischen 1999 und 2001 an der Reihe. Das Ausstellungsdatum des Kartenführerscheins ist auf der Vorderseite im Feld 4a eingetragen. Für den Umtausch des Dokuments ist die Fahrerlaubnisbehörde des aktuellen Wohnsitzes zuständig. Benötigt wird ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, ein biometrisches Passfoto, der aktuelle Führerschein und eine Gebühr von rund 25 Euro.
Quelle: dpa